- Details

Dr. Christine Miller setzt sich in der neuesten Ausgabe von Wild und Hund 2/2021 S. 12 f. mit Drückjagden auseinander und stellt die Frage, ob sie Problem oder Lösung sind. Wie entscheidend Drückjagden tatsächlich für gutes Jagdhandwerk sind und welche Folgen sie für Wild un Wald haben, wird ausführlich behandelt. Dass dabei eine ungeschönte Kritik an manch einer allgemein für gut befundenen Jagdpraxis geübt wird, dafür ist die Autorin ihrem treuen Leserkreis bekannt.
- Details

Foto: Christoph Burgstaller
Verhungern lassen ist keine Option! So überschreibt M. Vodnansky in der neuesten Ausgabe von Österreichs Weidwerk 2/2021 S. 16 f. seinen Beitrag zur Winterfütterung. Es entspräche dem Verständnis einer zeitgemäßen Jagd, das Wild vernünftig zu bewirtschaften. In extremen Situationen, also etwa bei hoher Schneelage dürfe man "... das Wild nicht dem Hunger und der Erschöpfung überlassen". Nicht nur Wildschäden werden durch die Wildfütterung minimiert, sondern sie ist auch als aktiver Tierschutz zu sehen.
- Details
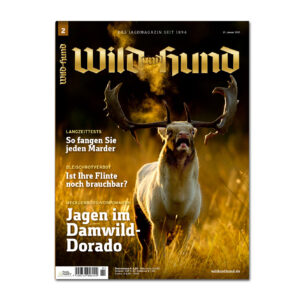
In Mecklenburg-Vorpommern kann man im Revier der Stiftung Wald und Wild die Damwildbrunft erleben. Heiko Hornung schildert in der neuesten Ausgabe von Wild und Hund Februar 2021 S. 43 f. Damwildhirsche auf dem Brunftplatz Vietower-Wiesen, wie sie im offenen Feld an ihren Brunftkuhlen auf das weibliche Wild warten. Kahlwild zieht zwischen den Brunftkuhlen umher und sucht sich einen Hirsch aus. Teilweise ragt nur noch das Haupt aus den tiefen Kuhlen hervor.
- Details
 Foto: Jagd in Tirol
Foto: Jagd in Tirol
Der Landesjägermeister von Tirol Anton Larcher fordert Wildruhezonen, gerade in Zeiten der Pandemie. In seinem Vorwort zur jüngsten Ausgabe von "Jagd in Tirol" Jänner 2021 S. 3 zeigt er die Schattenseiten eines überbordenden Bergtourismus auf. "Kaum liegt der erste Meter Schnee, stürmen Naturnützer regelrecht die Berge". Das Chaos: überfüllte Parkplätze, zugeparkte Zufahrtstraßen, auch vor der Bergwacht-Zentrale macht man die Zuwegung dicht, Stau am Berg. "Skitourengeher, Wanderer und sogar noch Radfahrer an den Fütterungen, die gerade jetzt vom Wild dringend benötigt werden."
- Details
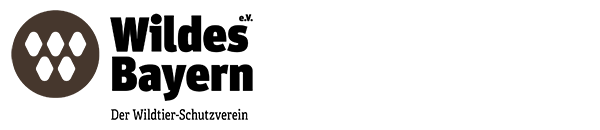
Der Hochwinter naht unaufhaltsam, Frosttage und Schneefall stehen uns ins Haus. An diese Bedingungen sind unsere Wildtiere bestens angepasst – wenn man sie ihre jeweiligen Winterstrategien verfolgen lässt. Doch leider erlauben wir gerade das nicht: Statt Ruhe gibt es Wintersportrummel und Drückjagden, statt Wanderkorridoren gibt es rotwildfreie Zonen, Straßendickicht und ausgeräumte Fluren. Und dort wo Reh und Hirsch ein karges Mahl zu sich nehmen möchten, muss die Douglasien-Plantage ohne eine einzige Knabberspur aufkommen. Unsere Blogbeiträge und Neuigkeiten bewegen sich in diesem Spannungsfeld. Winter sollte die Zeit der Ruhe und der Gelassenheit sein. Das hilft nicht nur im Umgang mit unseren Wildtieren, sondern tut auch der menschlichen Seele gut
- Details

Der Deutsche Jagdverband meldet:
Wie das zuständige Ministerium in Brandenburg bestätigte, gibt es einen ersten Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest in Groß Glienicke / Brandenburg an der westlichen Grenze zu Berlin. Die endgültige Untersuchung durch das FLI steht aus. Solange der Verdacht nicht bestätigt ist, bitten wir Sie, sich an keinerlei Spekulationen zu beteiligen.
- Details

Foto: Jagd in Bayern 12/2020
In der jüngsten Ausgabe von "Jagd in Bayern" Dezember 2020 S. 6 f. erläutert Landesjagdberater Gerhart Zwirglmaier, warum es unsere Hegeschauen braucht. Coronabedingt sind diese weitgehend für das laufende Jagdjahr abgesagt worden. Dennoch hat der Gesetzgeber eine Kontrollfunktion der Abschüsse als wesentlichen Bestandteil der Hegeschauen verbindlich vorgesehen. Allerdings ist die behördliche Über-wachung der Abschüsse im Sinne einer durch Abschussplan geregelten Bejagung nicht die einzige, wenn auch wesentliche Aufgabe der Hegeschauen. Der Verfasser weist auf das Bedürfnis einer zielgerichteten Information der Öffentlichkeit hin. Das bedeutet also mehr als nur eine Trophäenschau, wie dies vielfach geschieht. An mehreren Beispielen erläutert er, wie man der Allgemeinheit Zugang zur Jagd verschaffen und damit um Akzeptanz werben kann.
- Details

Foto: Goldschakal (Canis aureus) Wikipedia
Markus Marschnig und Hubert Zeiler berichten über die Ausbreitung des Goldschakals, insbesondere in der Steiermark. In der neuesten Ausgabe Dezember 2020 von "Der Anblick" auf S. 12 ff. schildern sie, wie der Goldschakal von seinen Ursprungsgebieten am Schwarzen Meer und in Dalmatien aus sich in Österreich verbreitet hat, also keine invasive Art ist. Der Goldschakal unterliegt dem Schutz der FFH-Richtlinie Anhang V und hat daher denselben Schutzstatus wie etwa Gams- und Steinwild. Der Goldschakal wird in der Steiermark mittlerweile als jagdbare Wildart geführt, har aber noch keine Jagdzeit. Das Gutachten von Hubert Zeiler betreffend die Beurteilung jagdlicher Maßnahmen fließt in die Novelle der steierischen Jagdzeiten-Verordnung ein, in Oberösterreich und im Burgenland ist schon eine Jagdzeit vom 1. Oktober bis zum 15. März festgelegt. Damit wird dem Druck auf Beutetiere wie Rebhuhn und Hase, aber auch auf die Raufußhühner Rechnung getragen, deren Schwinden durch Lebensraumverlust und Prädatorendruck begründet ist.
- Details
 Foto: Deutsche Wildtierstiftung
Foto: Deutsche Wildtierstiftung
Das Tier des Jahres ist nach Mitteilung der Deutschen Wildtierstiftung der Fischotter, eine einst fast ausgerottete Marderart. Nicht alle erfreuen sich an seiner Anwesenheit, denn er frisst meist seine Lieblingsspeise Fisch! Diese Marderart lebt am Lande wie am Wasser und geht vorwiegend in der Dämmerung auf die Jagd. Natürliche Seen und Wasserläufe ist ihr Lebensraum. Lesen Sie mehr in dem aktuellen Newsletter Dezember 2020 der Deutschen Wildtierstiftung: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=d9m6mw8z-o4a99o5v-ylt
- Details
Das Salzburger Modell wird von Hubert Zeiler in der Ausgabe November 2020 der Jagdzeitschrift "Der Anblick" auf S. 24 f. als eines der wichtigsten Instrumentarien zu einer zeitgemäßen Rotwild-bewirtschaftung beschrieben. Dabei spielt die Wildökologische Raumplanung des Forstbetriebes Pongau, dessen Leiter Hannes Üblagger von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) eine Betriebsfläche von ca. 50.000 ha verwaltet, eine wichtige Rolle. Geregelt wird über die Erfassung der Rotwildpopulation hinaus die Abschussplanung und Rotwildüberwinterung. Durch Zunahme und Bedeutung des Tourismus für das Land Salzburg, vor allem im Winter sind u. a. Wintergatter nötig geworden, die für eine ruhige und schadensfreie Überwinterung des Rotwildes garantieren.
- Details
 Foto: Jagd in Tirol, Ausgabe 11/2020 Titelseite
Foto: Jagd in Tirol, Ausgabe 11/2020 Titelseite
Einen weißen Gamsbock zu schießen, bedeutete früher Unglück, das innerhalb eines Jahres über den Schützen hereinbrechen würde. Zahlose Beispiele wären da anzuführen, so der einstige Thronfolger Franz Ferdinand, der sich nicht an den Rat seiner Jäger hielt und im Jahr darauf 1914 in Sarajevo Opfer eines Attentats wurde. Erfahrene alte Gebirgsjäger, die einst Könige und Kaiser auf Gamswild im Gebirge führten, prophezeiten deren Ende innerhalb eines Jahres und behielten oft genug recht, wenn sie vor dem Abschuß eines weißen Gamsbocks warnten. Lesen Sie mehr über den Mythos weiße Gams in dem Artikel von Siegfried Erker in der Ausgabe November 2020 von "Der Anblick" S. 58 f.
- Details

Foto: Kauer DJV
In Nordrhein-Westfalen sind Drückjagden auf Schalenwild von dem Versammlungsverbot nach Infektionsschutzgesetz ausgenommen, wie die Landesregierung bestätigt. Innerhalb von namentlich dokumentierten festen Gruppen von höchstens fünf Personen darf dabei auch der Mindestabstand notfalls unterschritten werden. Eine Teilnehmerbegrenzung gibt es nicht. Die Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt werden. Bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Teilnehmern gilt auch im Freien grundsätzlich eine Maskenpflicht.
- Details

Foto: Sternath Verlag OHG
Nikolaus Alexander Fegert schildert seine Eindrücke von Natur und Jagd in den Bergen in seinen Fotografien (Bilder vom Jagen). Neben der Büchse führt er seine Kamera mit sich, wenn es zur Jagd geht. Ständiger Begleiter ist sein Deutsch-Langhaar, ein ruhiger Jagdgebrauchshund mit weißer Decke und schwarzen Tupfen. Nach seinem Verleger Sternath widmet sich der 2020 in Mallnitz erschienene Bildband "der ältesten Tätigigkeit des Menschen, der Jagd. Er erzählt von dunklen Wäldern, vernebelten Seen, ausgesetzten Pfaden und mystischen Abenteuern. Er zeigt den Jäger als Teil der Natur." Das Vorwort hat geschrieben sein Onkel, der ehemalige Direktor des Jagd- und Fischereimuseums München, Bernd E. Ergert.
- Details

Foto: El Cóndor Pasa Spektrum de
Der größte flugfähige Vogel mit einem Eigengewicht von bis zu 15 Kilogramm kann 5 Stunden in der Luft bleiben und dabei 170 Kilometer fliegen. Biologen vom Max-Planck-Institut in Radolfzell haben Sensoren an Jungvögeln angebracht und dabei festgestellt, dass Andenkondore sich an Berghängen von der aufsteigenden Warmluft tragen lassen. Eine Notlandung soll möglichst vermieden werden, da das abermalige Starten zu viel Energie verschlingt. Wie es ihm gelingt, aufsteigende Luftmassen von weitem zu erkennen, ist noch ungeklärt. Man vermutet, dass er Vogelschwärme beobachtet, die in der Thermik kreisen.
- Details
 Foto: Verfasser
Foto: Verfasser
Der streng nach EU-Richtlinien geschützte Kormoran unterliegt nicht dem Jagdrecht. Anträge auf Abschussgenehmigungen erteilt die zuständige Landesbehörde nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, z. B. auch bei der Gefährdung von Teichwirtschaften. Hier kann er erheblichen Schaden anrichten. In natürlichen Gewässern wird er zwar angetroffen, aber normalerweise nicht bejagt. In Anklam hat es 2005 eine Genehmigung gegeben, auf Veranlassung der Fischerei- und Teichwirtschaft wurden etwa 6000 Vögel erlegt, hierbei auch Äst- und Nestlinge, was zu einer Geldbuße von 3000 € führte und weit schlimmer zum Erlöschen einer ganzen Kolonie. Der von weitem unscheinbare, schwarze Vogel entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein metallisch-grün und messing- farbenes Subjekt, das grüne Auge weist ihn der Familie der Tölpel und Fregattvögel zu. Corvus marinus, also Meerrabe ist eine durchaus zutreffende Bezeichnung. Auffallend sind die zum Trocknen ausgebreiteten Schwingen, die sich bei seinen Tauchgängen voll Wasser saugen und so wenig Auftrieb verursachen.
- Details
 Foto: Jagd in Tirol
Foto: Jagd in Tirol
Über die landesweite Steinwildzählung in Tirol im Jahr 2020 berichtet Martina Just und der Steinwildreferent Peter Stecher im Oktoberheft 2020 von "Jagd in Tirol" auf S. 10 ff. Dieses Monitoring findet schon zum 3. Mal in Tirol im Intervall von jeweils fünf Jahren statt. Die Zählungen werden in den sog. Kolonien, also ortsnah im Lebensraum des Wildes durchgeführt und finden je nachdem im Sommer oder im Frühjahr statt. Sie liefern aber kein genaues Bild, weil die Dunkelziffer des nicht erfassten Wildes relativ hoch ist. Insgesamt sind steigende Bestände seit der Wiederansiedlung in 1953 in Tirol zu verzeichnen. Landesweit spricht man von einem Mindestbestand von ca. 5.583 Stück. Aktuelle Forschungsergebnisse legen dar, dass eine Steinwildkolonie bei Erreichen der Lebensraumgrenze ca. 150 Stück in ausgeglichenen Alters- und Sozialstrukturen umfassen sollte, um als gesicherte Population zu gelten.
- Details
Eine neuere Studie von Dr. Luca Corlatti, Universität Freiburg untersucht die Konkurrenz von Rot- und Gamswild. Im Nationalpark Stllfser Joch wurde mit Langzeitdaten wissenschaftlich nachgewiesen, dass Rotwild den Rückgang von Gamswild verursachen kann. Die Studie "long-term dynamics suggest interspecific competition" von Luca Corlatti, Anna Bonardi et. al. wurde 2019 im Journal of Zoology Vol. 309, S. 241-249 veröffentlicht.
- Details
 Foto: Verfasser
Foto: Verfasser
Rotwild ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. Längst besiedelt es nicht nur die für die Patentjagd bekannten Gebirgskantone. Nach einem Bericht von Hubert Zeiler in der Ausgabe Oktober 2020 von "Der Anblick" auf S. 28 ff. taucht es nun auch in den Revierkantonen auf. Doch überall scheint das Wild willkommen zu sein, wenn auch die jagdlichen Regeln von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind. "Rotwildfreie Zonen", wie bei uns in Deutschland, sind jedenfalls für die Eidgenossen kein Thema. Der Leiter der Sektion Wildtier und Artenschutz im Bundesamt für Umwelt in Bern, Reinhard Schnidrig bringt es auf einen kurzen Nenner: "Wo Lebensraum, da Lebensrecht". Die Hirsche kommen im Winter sogar in die Tallagen, beispielsweise in das Rheintal zwischen Grabs und Vaduz, ein immerhin dicht besiedeltes Gebiet. Dieser Umstand ist allerdings geschichtlich bedingt, der Befreiungsdrang der Eidgenossen hat in den Gebieten mit romanischen Wurzeln dafür gesorgt, dass die Jagd nicht an Besitz von Grund und Boden gebunden ist, wie in den germanischen Gebieten. Sie ist lediglich beim Kanton hoheitlich geregelt.
- Details
Die Anpassungsfähigkeit des Rotwildes führt in vielen Revieren dazu, dass trotz steigender Bestände die Sichtbarkeit und damit die Bejagbarkeit aus vielerlei Gründen abgenommen haben. Eine Telemetriestudie des IWJ BOKU Wien an 20 Hirschen und Tieren in einem Gebirgsrevier des Salzburger Pinzgau's über 3 Jahre zeigt auf, wie sich für das Wild zunehmend eine "Landschaft der Furcht" ergibt, in der es sich tagsüber nicht sehen läßt. Gründe dafür sind die Lernfähigkeit von Rotwild sowie der nachgewiesene Einfluss der Jagd auf die Lebensraumnutzung. In der Ausgabe Oktober 2020 der Zeitschrift St. Hubertus wird auf S. 8 ff. von dem Team um Prof. Dr. Klaus Hackländer aufgezeigt, durch welche gezielten Jagdmethoden und -strategien wie Schwerpunktbejagung und Intervalljagden in Kombination mit Wildruhezonen das Wild wieder vermehrt bei Tageslicht in Anblick gebracht werden kann.
- Details

Foto: Verfasser
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer, Institutsvorstand für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien, wird zu Jahresbeginn in der renommierten Deutschen Wildtier Stiftung neue berufliche Herausforderungen annehmen und als Vorstand die Geschäfte der Stiftung führen. Um Synergien für die Universität für Bodenkultur Wien und die Deutsche Wildtier Stiftung zu entwickeln, wird Hackländer seine Professur an der BOKU aufrechterhalten und an der „Universität des Lebens“ in geringem Umfang in Forschung und Lehre weiterhin aktiv bleiben.

