- Details
Foto: Teichwirtschaft Lhotka, Bezirk Budweis
Im Oktober werden die Teiche um Lhotka, Bezirk Budweis, Südböhmen abgefischt, hauptsächlich gehen Karpfen ins Netz. Ein traditionelles Vorspiel-seit mehr als hundert Jahren-erfordert den Einsatz von Flugwildschützen. Aberhunderte von Enten, meist Stockenten, ebenfalls wie die Karpfen gezüchtet, müssen zuvor geschossen werden, meist Anfang September. Seit Jahren kommen immer wieder Gruppen begeisterter Flugwildschützen zusammen, um hier ihre Fertigkeit unter Beweis zu stellen, Schützen und Loader haben sich aufeinander eingestellt, zu dicht kommt Schoof nach Schoof baumhoch über die Teiche pfeilschnell geflogen. Schwesternflinten sind keine Seltenheit. Wer dieses Schauspiel verfolgt, kann das Reaktionsvermögen und die jahrelange Routine bewundern, die die Schützen beherrschen. Strecken von mehreren Hundert Enten sind keine Seltenheit. Ein Beispiel einer solchen Jagd ist unter dem Button Publikationen (8.9.2024) wiedergegeben.
- Details
Wilhelm Leibl's Bildnis "Der Jäger", entnommen Der Anblick 08/2024
Das Bild zeigt Anton Freiherr von Perfall und war im zweiten Weltkrieg verschollen. Harald W. Vetter hat in der Ausgabe August 2024 der Jagdzeitschrift "Der Anblick" auf S. 58 f. sich mit dem Künstler befasst, der Motive aus dem bayerischen Landleben bevorzugte. Das Gemälde "Leibl und Sperl auf der Hühnerjagd" ist ebenso auf dieser Website beschrieben. Der 1844 in Köln geborene Künstler gilt als maßgeblicher Realist der deutschen Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Eins der eindruckvollsten Portraits im bayerischen Umfeld ist das von seinem Freund Perfall, aus bayerischem Uradel stammend. Perfall ist auch als Schriftsteller in Süddeutschland bekannt, Novellen und Erzählungen über die Jagd waren seine hauptsächlichen Themen. Das Bildnis zeigt den jungen Jäger in üblicher bayerischen Tracht, eine Hahnflinte hat er sich umgehängt, er trägt einen Entenlocker in der Hand, es geht wohl, der nahe Teich läßt es vermuten, auf Entenjagd. Einen englischen Pointer hat er abgelegt.
- Details
Foto: Der Anblick Juli 2024 S. 54
Im Salzburger Blühnbachtal wurde vor 100 Jahren eine der ersten Steinwildkolonien wiederbegründet, wie "Der Anblick" Heft Juli 2024 auf S. 54 f. schreibt. Nach dem fast vollständigen Erliegen des Bestandes in weiten Teilen des Alpenraumes siedelte Gustav Krupp 1924 in seinem Revier Blühnbach Kitze aus der Schweiz an. Trotz immer wieder zu verzeichnender Rückschläge durch Räude und Gamsblindheit etc. konnten bei der letzten Zählung im April 2023 insgesamt 160 Stück der mittlerweile angewachsenen konstanten Steinwildpopulation erfasst werden. Die Steinwildhegegemeinschaft betreut ca. 23.560 ha. Am 4. Juli findet auf der Burg Hohenwerfen eine Jubiläumsveranstaltung und Eröffnung einer Sonderausstellung der Salzburger Jägerschaft statt, diese kann bis zum 3. November besichtigt werden. Interssant sind auch die historischen Bezüge auf das Krupp'sche Revier und Schloss Blühnbach, dass bis 1986 von Arndt von Bohlen und Halbach bewohnt wurde.
- Details

Foto: Simone Lechner
Die Jagdwirtegruppe Südtirol, also ein Zusammenschluss in der Alumni Jagdwirt-Gruppe des Akademischen Jagdwirts der Universität für Bodenkultur Wien beabsichtigt, ein Leitbild und eine nachhaltige Organisationsstruktur für die Absolventen des Akademischen Jagdwirts zu erarbeiten. Als übergeordnetes Ziel wird die "Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz einer nachhaltigen und tierethischen Jagd" verstanden. Hintergrund ist die Abschlussarbeit eines Jagdwirtes aus Südtirol, die sich mit dem Thema näher befasst.
- Details
In zweiter, überarbeiteter Auflage gibt Christian Carl Willinger eine allgemeinverständliche Einführung in die Jagdtheorie wieder (CCW-Verlag Linz, 2024). Warum jagt der Mensch? Ist Jagd aus moralischer Sicht zu verwerfen? Willinger geht der Frage nach, was eigentlich Jagd ist und weshalb sie beim Menschen als kulturelles Phänomen in Erscheinung tritt. Nach seiner Ansicht hat sie einen tiefenpsychologischen Ursprung wie das Religiöse. Eine Zusammenfassung der Jagdtheorie sowie wissenschaftlich fundierte Antworten auf der Höhe der Zeit auf die Kernfragen zur Jagd ergänzen diese zweite Auflage.
- Details
Ein Nachdruck der Originalausgabe von Eugen Wyler's "Grüne Kinderstube, ein Beitrag zur moralischen Jägerbildung", erschienen im Sternath-Verlag Mallnitz 2024 ruft Jäger wie Förster zur gemeinsamen Erhaltung von Wild und Wald auf. Im Februar 1955 führte dieser Aufruf zur Gründung des "Silbernen Bruchs, des Ordens zum Schutz von Wald, Wild und Flur und zur Förderung des weidgerechten Jagens." Siebzig Jahre danach ist das Buch immer noch aktuell und lesenswert.
- Details
 Foto: Archiv des Verfassers
Foto: Archiv des Verfassers
Es kann Argumente für die Jagd auf Wölfe geben, sagt John Linnell im Interview der FAZ mit Petra Ahne vom 15. April 2024 auf S. 9. Linnell ist Senior Research Scientist am norwegischen Institut für Naturforschung und Wildtiermanagement der Inland Norway University of Applied Science, er war Leiter der NINA-Studie zu Angriffen von Wölfen auf Menschen. Dass der Wolf so strikt geschützt ist, ist ein Teil des Konflikts mit ihm, meint Linnell. "Wenn es gelegentlich erlaubt ist, Wölfe zu töten, wird es wahrscheinlich keinen messbaren Effekt auf die Zahl der getöteten Schafe haben. Aber einige Menschen hätten das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben, und das kann ziemlich wichtig sein. Wenn jemand sagt, dass er Wölfe schießen will, um seine Schafe am Leben zu halten, klingt das für eine breite Öffentlichkeit in Ordnung. Zu sagen, dass man Wölfe töten will, weil es einem das Gefühl gibt, die Kontrolle zu haben, wird nicht so gut ankommen, obwohl es wahrscheinlich mehr der tatsächlichen Motivation entspricht. Eine Zunahme der Jagd wird allerdings für einen riesigen Konflikt mit den Menschen sorgen, die für den Wolf sind."
- Details

Foto: Archiv des Verfassers
Der Bestand an Auerwild sinkt weiter, wie Susanne und Friedrich Reimoser in der April Ausgabe 2024 von "Der Anblick" auf S. 26 ff. berichten. Wälder, die auf großer Fläche sehr dicht werden, meidet das Auerwild. Ein Hauptproblem ist der zunehmende Kronenschluß der Wälder. Mangelnde Durchforstung und Auflichtung des Waldes gehen einher mit verminderter Beweidung. Günstig wäre lückiger und weideähnlicher Aufbau, kahle Bodenflächen und Zwergsträucher wie Brombeere. Nadelbaumarten erhalten die Äsung im Winter, trockene Frühlingswitterung ist für das Überleben des Nachwuchses wichtig. In Österreich kann im Frühjahr auf den Auerhahn gejagt werden, die FFH-Richtlinie läßt unter bestimmten Voraussetzungen eine geringe Zahl von Abschüssen zu: Erfassung der Bestände durch ein systematisches Monitoring, selektiver Abschuss nach der Hauptbalz von nicht dominanten Hahnen, Bestätigung von mindestens 16 Hahnen in einem zusammenhängenden Gebiet, um nur einige Beispiele zu nennen. Immerwieder: Die gezielte Lebensraumgestaltung durch den Jäger, d.h. aber auch Regulierung von Fressfeinden, die Eier und Jungvögel dezimieren.
- Details
Foto: Michael Migos
Julia Gerzer, Ärztin und akademische Jagdwirtin aus Hüttschlag im Großarltal berichtet in "Jagd in Bayern" Ausgabe April 2024 auf S. 54 f. von einem kürzlichen erneuten Ausbruch der sog. Hasenpest. Die auch für Jäger bedrohliche Zoonose kann durch Haut- oder Schleimkontakt mit infektiösen Tieren oder durch Parasiten ausbrechen, mit denen die Erde, Heu oder Kadaver befallener Tiere verseucht sind. Dabei wird der Hase als einer der Hauptüberträger der Tularämie in Mitteleuropa angesehen. Betroffene Tiere wirken häufig geschwächt, eine deutlich vergrößerte Milz und geschwollene Lymphknoten sind die Folge. Auch Zecken fungieren als Überträger. Aufgrund der Klimaerwärmung treten die Erreger mittlerweile ganzjährig auf. Beim Abbalgen von Hasen empfiehlt sich, Handschuhe und Maske zu tragen. Dem Gesundheitsamt ist der Ausbruch der Krankheit innerhalb eines Tages zu melden.
- Details
Foto: dpa/faz 26. März 2024
Der Feldhase gilt in Deutschland als gefährdete Art. Jakob Krembzow berichtet in der FAZ vom 26. März 2024 auf S. 7 von neuesten Zahlen, wonach es dem Hasen wieder besser geht. Wesentlicher Grund dafür war das günstige Wetter im Frühjahr 2023, wäre es nass und kalt gewesen sähe die Statistik anders aus. In solchen Jahren ist der Nachwuchs in Gefahr, das Fell verklebt durch die Nässe und isoliert nicht mehr. Man könne sagen, dass der Hase durch den Klimawandel und die steigenden Temperaturen eher gewinne als in den kalten Frühjahren der vergangenen Jahrzehnte. Auch die Deutsche Wildtierstiftung sieht die aktuelle positive Entwicklung, warnt aber vor einem vorschnellen Trend. Vielerorts seien die Bauern von der Pflicht zur Brachlegung entbunden, so dass durch intensive Landwirtschaft die Gefahr bestehe, dass den Hasen Lebensraum entzogen wird. Es bleibe zu hoffen, dass viele Hasen durch den nicht allzuharten Winter gekommen seien, Hochwasser im Frühling wie in manchen Teilen Deutschlands sei aber für viele Jungtiere fatal gewesen.
- Details
Foto: Schwärzler(1), Jagd in Tirol 03/2024
Einen interessanten Beitrag zum Thema "Wildverbiss, kann er nützlich sein?" findet man in der März-Ausgabe von "Jagd in Tirol" Heft 03/2024 auf S. 32 f. Der Autor Stefan Fellinger räumt mit der generellen Meinung auf, Wildverbiss sei ökologisch und insbesondere forstwirtschaftlich immer von Schaden. Es könne nämlich auch durchaus sein, dass Wildverbiss keine Auswirkungen auf die Baumartmischung habe. Er verweist auf eine Studie von Nopp-Mayr et. al. aus 2023, wonach im Höllengebirge nach 30 Jahren in einer gezäunten Jungwuchsfläche es keinen Unterschied zu der benachbarten ungeschützten Fläche gegeben habe. Dem Wild sei sogar eine positive Mischungsregelung zugekommen, indem jene Arten bevorzugt verbissen werden, die sich zahlreicher und rascher vermehren, die also ökologisch gegenüber anderen Arten konkurrenzfkräftiger sind und diese ohne Verbiss leichter verdrängen könnten. Diesen Entwicklungsprozess durch den Wildverbiss an Pioniergehölzen könne man auch als "Läuterungsarbeiten gratis bestellt" bezeichnen. Unter deren Schutz wachsen dann Schlusswaldbaumarten wie Tanne, Buche und Fichte heran, die unter den gegebenen Bedingungen das Endstadium der Vegetationsentwicklung darstellen.
- Details
Foto: Drentsche Patrijshonden Club Nederland
Im Englischen wird er als Drentsche Partridge Dog, im Französischen als Chien de perdix de Drente, im Deutschen als Drentscher Hühnerhund oder auch Rebhuhnhund bezeichnet, der Drentsche Patrijshond. Angelika Glock berichtet in der Februar-April Ausgabe der Zeitschrift Halali 01/2024 auf S. 100 f. von der alten niederländischen Jagdhundrasse. Der Drent wurde früher in bäuerlichen Jagden auf Niederwild eingesetzt. Mit seinem weißen, scheckigen Fell war er in den damals noch reich an Rebhühnern und Fasanen bescherten klein parzellierten Jagden gut für den Jäger zu verfolgen, wenn er kurz unter der Flinte arbeitete. Auch heute noch ist der in 2014 gegründete Drentsche Patrijshonden Club Nederland stolz auf die Wiederentdeckung der alten Hunderasse. Der Drentsche Patrijshond ist durch seine Vielseitigkeit im jagdlichen Bereich bekannt, sei es durch die Arbeit nach dem Schuss oder seine Apportierfreudigkeit. Kreisförmige Bewegungen seiner Rute während der Jagd kennzeichnen seinen Rassestandard. Seine Ähnlichkeit mit dem Kleinen Münsterländer hilft ihm hierzulande zu einiger Popularität.
- Details
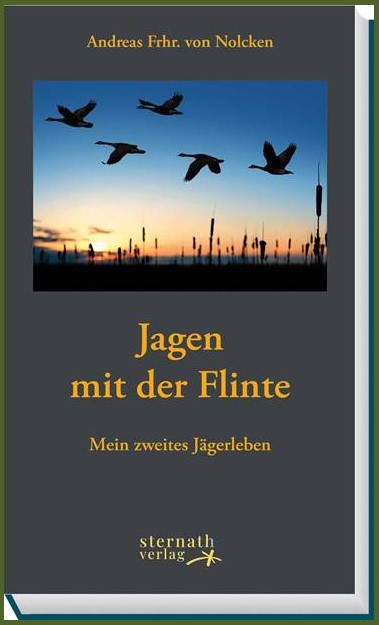
"Jagen mit der Flinte, Mein zweites Jägerleben" nennt Andreas Frhr. von Nolcken sein im Sternath Verlag Mallnitz 2023 herausgebrachtes Buch. Er schildert seine früheren Jagderlebnisse mit der Büchse, im Flachland wie auch im Hochgebirge. Mit zunehmendem Alter wendet er sich der Flinte zu, die Vogeljagd wird mehr und mehr sein spezielles Jägerleben. Dabei sind seine Erlebnisse nicht nur auf seine heimischen Reviere im Süden Deutschlands, wo er auch lebt, beschränkt. Die Jagd auf Fasanen, Rebhühner und Grouse im Vereinigten Königreich, aber zum Beispiel auch in Burgund erzählt er in unterschiedlichen Facetten. Besonders angetan hat ihn die Jagd auf Wasserwild wie Ente und Wildgans sowie die damals noch gestattete Schnepfenjagd im Frühjahr. Legendär sind die Manufakturen seiner Waffen, Namen wie Purdey und Holland & Holland begeistern jeden Flintenjäger. Dass bei aller Bewunderung für das handwerkliche Können der Büchsenmacher die eine oder andere Flinte nicht zum jagdlichen Einsatz kommt, sondern eher seine umfangreiche Waffenkammer schmückt, versteht jeder Waffennarr.
- Details

Foto: Steierischer Schießsportverband (Bobolik Nr.1)
Im Interview mit Walter Bobolik in der Jagdzeitschrift "Der Anblick" Ausgabe Februar 2024 S. 88 f. befasst sich Thomas Hinterecker mit dem Thema "Schießen ohne Alterslimit". Gemeint ist nicht nur der Erfahrungsschatz als Jäger, sondern auch das Training als Sportschütze und die Teilnahme an Wettbewerben. Warum das im Alter so wichtig sein kann, sich an extrem schnellen und beweglichen Zielen, also am Wurfscheibenschießen fit zu halten, erklärt Bobolik so: Hoch konzentriert und redaktionsschnell einen Trainingstag durchzustehen macht richtig müde und im Kopf "leer". Belastende Gedanken bleiben zuhause. Bei der Formel I und der Ausbildung von Jet-Piloten gehörte dieser Sport in früheren Zeiten zum Standard-Trainingsprogramm. Der Eintritt in einen Wurfscheiben-Sportverein kann sich daher auch im Alter lohnen, Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsvermögen spielen schließlich gerade im Alltag eine große Rolle. Ein Berufskollege habe ihm, so Bobolik, vor 55 Jahren prophezeit: "Wenn du in einen Wurfscheibensport einsteigst, kannst du nie mehr aufhören" und bleibst fit.
- Details
Foto: Athesia Verlag Bozen 2021
Markus Moling ist seit 2016 ordentlicher Professor für Philosophie an der Philosophisch Theologischen Hochschule in Brixen, Südtirol. Umweltethik, Naturverständnis und vor allem der Umgang mit wildlebenden Tieren, wozu auch die Jagd gehört, sind dabei einige seiner Forschungsschwerpunkte. Zum Thema "Wie Wir Jagen Wollen" hat er ethische Überlegungen im Umgang mit Wildtieren im Athesia Verlag mit einem Vorwort des Moraltheologen Martin Lintner 2021 (2. Aufl. Bozen) herausgegeben. Der Philosoph Moling hält sich nicht mit Lippenbekenntnissen zur Jagdethik auf, sondern nimmt zu praktischen Alltagsthemen der Jagd Stellung, wobei er dem Jäger schonungslos ins Gewissen redet. Vor dem Hintergrund der vermehrten Kritik der Tierschützer an der Jagd und der schwindenden Unterstützung durch die Öffentlichkeit zeigt er Wege auf, wie die Jagd das gesellschaftspolitische Ansehen zurückgewinnen kann, ohne sich ins ideologische Abseits zu verirren. Er räumt allerdings auch auf mit Vorbehalten gutmeinender Experten, die dem Jäger die Freude an der Jagd verderben wollen, indem sie ihm das Töten von Wildtieren aus ethischer Perspektive als verwerflich vorhalten: "Jäger töten nicht, sondern sie entnehmen nur Wild". Das Töten eines wildlebenden Tieres muss allerdings gut begründet sein, dabei geht es nicht um Trophäenkult oder sportlichen Wettkampf, da sie sich ethisch nicht rechtfertigen lassen, es geht um den Schutz von Ökosystemen, um die Sicherung des Lebensraums und die Erhaltung der Biodiversität. Nutzung der Natur durch den Menschen und deren Schutz müssen also keine Gegensätze sein.
- Details
 Foto: Budimir Jevtic/shutterstock
Foto: Budimir Jevtic/shutterstock
Michael Sternath schildert in der Januar-Ausgabe von "Jagd in Tirol" 2024, S. 34 f. das "Paradies der Hirsche" auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz. Ohne Weiteres käme man nicht auf den Gedanken, dass auf diesem ca. 23.000 ha großen Truppenübungsplatz der Amerikaner, Anfang des 20. Jahrhunderts von Kaiser Wilhelm II. angelegt, Rotwild sich derart wohl fühlen könnte. Die nähere Schilderung des Konzepts des langjährigen Forstmanns Maushake, ein großflächiges unzerschnittenes Gebiet mit wenig Erschließung, kaum Störfaktor Mensch, abgesehen von der militärischen Nutzung, keine intensive Landbewirtschaftung und keine Pestizide vorzusehen, sichert den Erfolg. Die Erhaltung der Ruhe auf den Offenflächen bietet dem Rotwild die Gelegenheit, Landschaftspflege zugunsten der Aufgabe Truppenübungsplatz zu betreiben, d. h. also Offenflächen für die Übungen freizuhalten. Eine klare Jagdstrategie ab Mitte Oktober, ein Jahressoll von ca. 1.500 bis 1.800 Stück, das bei höchster (Schuß-) Qualität der eingeladenen Jäger erfüllt werden soll, danach absolute Ruhe rundet den Erfolg ab. Einzelansitze auf Kahlwild, eine begrenzte Anzahl von Wildjagden, das ist die erwünschte störungsarme Jagd, oder wie Maushake es ausdrückt, "die heilige Ruhe" auf den Offenflächen, die das Wild braucht.
- Details

Foto: Raimund Krabacher, Bschlabs/Jagd in Tirol/Ausgabe Dezember 2023
Martina Just und Christine Lettl vom Tiroler Jägerverband berichten in der Ausgabe Dezember 2023 von "Jagd in Tirol" auf S. 16 ff. von der Steinwildtagung in Kals am Großglockner. Interessant dürfte aber besonders der Hinweis auf die unterschiedlichen Vorraussetzungen der Bejagung in den einzelnen Kantonen der Schweiz sein. So ist etwa in Graubünden die Bejagung von Steinböcken bzw. deren Altersklassen vom Alter der Jäger abhängig. Ein zehnjäriger Bock steht nur einem 55jährigen und älteren Jäger zu; zudem muss er 5 Hochjagdpatente gelöst haben, um überhaupt zur Jagd zugelassen zu werden. Ist man nun zugelassen, wird ein Ausbildungsabend und ein Begehungstag Pflicht. Der Jäger hat dann 20 Tage Zeit, muss aber zunächst eine nicht führende Geiß erlegen und anschließend den zugewiesenen Bock der Altersklasse. Danach hat man 10 Jahre zu warten, bis man sich erneut anmelden kann. Bei Fehlschüssen gibt es ein Bußgeld bis zu 500 CHF, die Trophäe wird beschlagnahmt, das Wildpret muß zu 9 CHF/kg abgenommen werden.
- Details

Foto: Archiv des Verfassers
Im Herzen Burgunds hat sich ein "driven game shoot" nach britischem Vorbild etabliert. Der Holländer Coen Stork bewirtschaftet das romantisch gelegene Schloß mit seiner Frau Catherine schon seit einigen Jahren, er als Veranstalter von Jagden auf getriebene Vögel ganz im Sinne von "wringshooting", sie als zauberhafte Gastgeberin und begnadete Köchin. Wer ein jagdliches Wochenende ganz im Stil britischer Society genießen will und dabei gutes Essen sowie erlesene Weine erwartet, ist hier herzlich willkommen.
- Details

Foto: Archiv des Verfassers
In der Schweiz ist die Jagd auf den Wolf möglich. Nach einer Notiz in der FAZ vom 1. Dezember 2023 können Wölfe auch dann bejagt werden, wenn sie keine Nutztiere gerissen haben. Das Schweizer Bundesamt für Umwelt hat landesweit 12 der 32 Wolfsrudel freigeben. Bis zum 31. Januar 2024 gilt die Erlaubnis u.a. in Graubünden und Wallis. Die Wölfe haben sich auf rund 300 vermehrt, vor 3 Jahren war es nur ein Drittel. Allerdings dürfte die Bejagung im Winter angesichts der großen Streifgebiete schwierig werden. In der EU ist die Bejagung der Wölfe wegen des Schutzstatus durch die FFH-Richtlinie nicht möglich, nur in Ausnahmefällen wird die "Entnahme" bei hohen Nutztierverlusten oder möglichen Angriffen auf Menschen gestattet.
- Details

Foto: Deutsche Wildtierstiftung
Wiebke Hüster berichtet in der FAZ-Ausgabe vom 24. November 2023 über die Deutsche Wildtierstiftung und die nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt: "Wildnisgebiete z. B. sind u. a. unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten". Insgesamt besitzt die Deutsche Wildtierstiftung 7750 Hektar, auf denen Naturschutz in unterschiedlichen Formen verfolgt wird. Die von Haymo Rethwisch zunächst in der Lüneburger Heide, dann in Vorpommern im Gut Klepelshagen renaturierten Habitate für Wildtiere vereinen ökologische Landwirtschaft, naturnahe Forstwirtschaft und waidgerechte Jagd. Wildlebende Rothirschrudel sieht man am hellen Tag, teilweise Tang äsend im nassen Küstenstreifen. Stiftungsvorstand Klaus Hackländer weist auch auf geschützte Arten wie die Trauerseeschwalbe und bestimmte Fledermäuse hin. Landwirtschaft und Artenschutz müssten kein Gegensatz sein. Bereits 2030, so das Ziel der europäischen Biodiversitätsstrategie sollen 10 Prozent der Fläche in der EU streng geschützt sein. Dann ist auch Schluss mit der Torfstecherei und der Wiedervernässungsprozeß kann beginnen.










